
© Pedro Morazán, 03.02.2025
"Herr, die Not ist groß!
Die ich rief, die Geister
werd ich nun nicht los.“
Wolfgang Goethe: “Der Zauberling”
Um eine kurze Besprechung des neuesten Buches von Yuval Noah Harari vorzunehmen, erscheint es ratsam, sein bisheriges Werk zu berücksichtigen, unter dem sein berühmter Bestseller „Homo Sapiens“ hervorsticht. „Nexus“ ist ein Buch über Informationen. Genauer gesagt eine Abhandlung über Netzwerke, die durch den Austausch von Informationen entstehen: „Informationen“, sagt der Autor, „sind der Klebstoff, der Netzwerke zusammenhält.“ Das wichtigste Thema des Buches ist ohne Zweifel die Beziehung zwischen Informationsnetzwerken und Macht. Schon im Prolog seines Opus fragt Harari: „Warum gelingt es uns so gut, mehr Informationen und Macht anzuhäufen, aber viel weniger, Weisheit zu erlangen?“ In Anspielung auf den mahnenden Text von Wolfgang Goethe, in dem ein Zauberlehrling erschrocken äußert: „Die Geister, die ich rief /werd ich nicht los.“ Harari erinnert uns daran, dass wir mit künstlicher Intelligenz, Chatbots, „X“ und anderen algorithmischen Geistern Monstern Leben einhauchen, die wir, wie in „Der Zauberlehrling“, nicht mehr kontrollieren können.
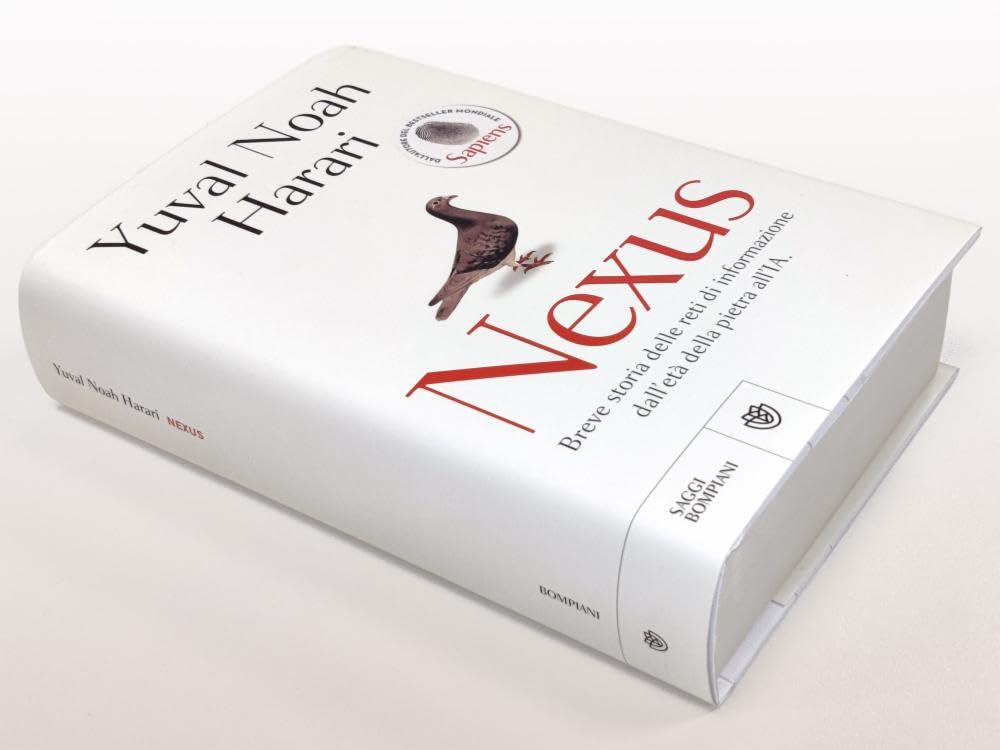
So sehr wir auch versuchen, ihm zu entkommen, indem wir von der Küche ins Schlafzimmer rennen, ohne einen Blick auf den Fernseher oder die Titelseite einer Zeitung zu werfen, es ist unmöglich, in diesen turbulenten Tagen nicht auf die clowneske Maske des reichster Mann der Welt, Elon Musk zu stoßen. Sein spöttisches Gesicht scheint den politischen und kulturellen Diskurs des Augenblicks zu dominieren. Die Rolle, die das Netzwerk durch die schamlose Verbreitung von Intrigen und Irrtümern über sein Netzwerk „X“ bei Trumps Wahlsieg gespielt hat, ist unbestreitbar. Sein Machtstreben führt ihn nun dazu, seinen bösartigen Schatten zu werfen, indem er schamlos rassistische rechtsextreme Parteien in Europa fördert und Homosexuelle und Prominente angreift. All dies scheint die zentrale These von Hararis Werk zu bestätigen: „Die Menschheit erlangt enorme Macht durch den Aufbau ausgedehnter Kooperationsnetzwerke, doch die Art und Weise, wie diese Netzwerke aufgebaut werden, verleitet sie zu einem rücksichtslosen Machtmissbrauch.“
Um die Logik von Hararis Argumentation zu verstehen, müsse man andererseits davon ausgehen, dass der Mensch eine „naive Vorstellung davon hat, was Information ist.“ Diese Naivität rührt von unserer Überzeugung her, dass Informationen in ausreichender Menge zu Wahrheit und Weisheit führen. Das heißt: Je mehr Informationen wir erhalten, desto besser für uns. Wir gehen daher naiv davon aus, dass künstliche Intelligenz (KI) als die leistungsstärkste heute verfügbare Informationstechnologie uns zur Lösung aller bestehenden Probleme führen wird.
Harari gliedert sein Werk in drei große Teile: Im ersten beschreibt er die menschlichen Informationsnetzwerke aus historischer Perspektive („seit der Steinzeit“). Diese historische Perspektive ist von entscheidender Bedeutung, um zu verstehen, was heute geschieht, und um die Gefahren zu analysieren, die uns in Zukunft drohen. Im zweiten Teil dreht sich der Vorschlag um die Idee, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte anorganische Informationsnetzwerke mit enormen Auswirkungen schaffen. In einem dritten Teil beschäftigt sich der Autor mit der Frage, was eine Art Informationspolitik sein könnte, ausgehend von der Idee der Demokratie als geeignetem Rahmen für das, was er Konversation nennt. Zwar ist es richtig, dass die Demokratie ein enormes Potenzial zur Bewältigung des Problems bietet, doch stimmt es auch, dass die KI das Machtgleichgewicht zugunsten des Totalitarismus verschieben könnte.
Im Lichte der Debatte über die Notwendigkeit, Kontrollmechanismen für künstliche Intelligenz einzuführen, sind die Überlegungen des Autors zum Thema Populismus im Prolog interessant. Die Argumente populistischer Führer wie Trump, Putin in Russland oder Erdogan in der Türkei ersetzen die naive Vorstellung von Information und behaupten, das Streben nach Macht sei der rote Faden des menschlichen Geistes. „Fakten“ oder „Wahrheiten“ erhalten daher einen relativen Charakter und werden durch einen opportunistischen Nihilismus ersetzt, der in vielen Fällen sogar die Rolle der Wissenschaft und der Experten in Frage stellt. Der narrative Trugschluss des nihilistischen Populismus macht Wissenschaft und Experten zu Machtinstrumenten der sogenannten „korrupten Eliten“, die die große Mehrheit beherrschen. Die Ernennung des prominenten Verschwörungstheoretikers Robert Kennedy Jr. zum US-Gesundheitsminister ist nur eines von Tausenden Beispielen, die diese These untermauern.
Das Hinterfragen von Fakten und deren Wahrheitsgehalt als Machtwaffe ist keine ausschließliche Eigenschaft von Rechtspopulisten. Laut Harari stellten auch Intellektuelle wie Foucault und Edward Said wissenschaftliche Institutionen wie Krankenhäuser und Universitäten in Frage, da sie davon ausgingen, dass diese im Dienste kapitalistischer oder kolonialistischer Eliten stünden. Zu dieser Liste könnten wir noch den Diktator Nicolás Maduro in Venezuela hinzufügen, für den Wahlergebnisse keine Rolle spielen, wenn es um die Billigung von Wahlbetrug geht. Wenn jemand einen Betrug behauptet, reicht es aus, den Urheber zu überprüfen, um die Gültigkeit der Behauptung in Frage zu stellen.
Der Nihilismus, auf den sich die Populisten berufen, erstreckt sich zudem auf das gesamte Spektrum wissenschaftlicher Erkenntnisse. So kann etwa die Existenz des Klimawandels angezweifelt werden, obwohl Hunderte Wissenschaftler aus zahlreichen Disziplinen und Ländern, die in einem gigantischen Forschungsnetzwerk Daten und Informationen zusammengetragen haben, ihn als Belege dafür bestätigt haben. Eine einzelne Person kann mit einer einzigen Aussage die institutionelle Arbeit eines Netzwerks wissenschaftlicher Institutionen in Frage stellen, die Tag und Nacht arbeiten. Aus diesem Grund suchen charismatische populistische Führer im Allgemeinen nach göttlichen Erklärungen, anstatt nach wissenschaftlichen Erkenntnissen. Viele dieser Führer verknüpfen ihre Macht mit religiösen Dogmen, seien sie nun evangelisch wie im Fall Trump oder islamistisch wie im Fall Erdogan.
An dieser Stelle möchte ich den wertvollen Beitrag des versierten venezolanischen Intellektuellen Moises Naim in seinem Buch „Die Rache der Mächtigen“ nicht unerwähnt lassen.Im ersten Teil beschreibt Naim, was er die drei „Ps“ nennt, nämlich Populismus, Polarisierung und Post-Wahrheit. Für Naim kommen die Gefahren, die die Demokratie bedrohen, nicht so sehr von außen, sondern vielmehr von innen und haben mit der Entstehung von Autokratien als Folge dieses gefährlichen Cocktails der drei Ps zu tun. In Bezug auf die Analyse moderner Machtstrukturen scheint Naim etwas weiter zu gehen als Harari, wenn er „Amazon“ als Beispiel für die außerordentliche Konzentration wirtschaftlicher Macht in den Händen eines einzigen Unternehmens ansieht. Auch im Hinblick auf den „Nexus“ zeigt uns das Buch, welches Potenzial die Demokratie hat, die Kontrolle zurückzugewinnen.
Auf der Grundlage des oben Gesagten beginnt Harari seine Überlegungen mit der Frage, was Information ist. Der Autor ist sich der Risiken bewusst, die jede Definition birgt, und kündigt daher an, dass er uns keine allgemeingültige Definition des Begriffs "Information" anbieten wird. Das Buch bietet mehr als eine Definition von Information, es liefert eine recht detaillierte Analyse der Rolle, die Informationen in der Geschichte gespielt haben. Auch hier ist die Definition von Information im Kontext der Wahrheitssuche nichts weiter als eine „naive Vorstellung von Information“. Aber Vorsicht, es handelt sich hier nicht um eine nihilistische Vorstellung, die uns auf einem anderen Weg zur oben bereits erwähnten „Post-Wahrheit“ führt. Im Gegenteil, man geht davon aus, dass die Wahrheit, definiert als genaue Darstellung der Wirklichkeit, durch die Verwendung enormer Mengen fehlerhafter oder falscher Informationen in Frage gestellt werden kann.
Es besteht daher ein Unterschied zwischen „Fehlinformation“ und „Desinformation“. Im Gegensatz zum ersten, das unfreiwillig sein kann, geschieht Letzteres vorsätzlich. Das ist nicht dasselbe. Auch wenn die Meinungen und Gefühle verschiedener Menschen, Nationen oder Kulturen unterschiedlich sind, können sie keine widersprüchlichen Wahrheiten vertreten, denn sie alle teilen eine universelle Realität: In Honduras gilt das gleiche Gesetz der Schwerkraft wie in Deutschland oder China. Wer den Universalismus ablehnt, lehnt die Wahrheit ab. Andererseits ist die Wahrheit teuer. Um etwas zu verifizieren, sind normalerweise viele Ressourcen und viel Arbeit erforderlich. Im riesigen Ozean der Informationen braucht die Wahrheit einen Anstoß, um zu schwimmen, sonst sinkt sie.

Unsere Suche nach der Wahrheit durch den Kontakt, den wir über Netzwerke mit anderen Menschen knüpfen, ist nicht immer von Erfolg gekrönt. Die meisten dieser Informationen sind falsch. Um dies zu verstehen, ist es notwendig, ein weiteres grundlegendes Konzept zu analysieren: Ordnung. Der Anspruch menschlicher Netzwerke, „Ordnung“ zu schaffen, ist berechtigt, denn ein unkontrollierter Überfluss an Informationen kann zu Chaos und Autoritätsverlust führen. Um Ordnung zu schaffen, war die Wahrheit in der Geschichte jedoch nicht immer der am häufigsten beschrittene Weg. Im Gegenteil, die Erfahrung zeigt, dass Fiktion oder Fantasie in den meisten Fällen wirksamer sind, um Ordnung zwischen Tausenden oder Millionen von Individuen herzustellen, die behaupten, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Die Verbindung zu einer nationalen, ethnischen oder religiösen Identität und deren Schaffung hängen stärker mit dem Glauben an eine Geschichte zusammen, die für die Menschen Sinn ergibt. Für Hindus hat ein Bad im Ganges eine größere reinigende Wirkung, als sich mit Wasser aus einem Becken am Eingang einer Kirche ein Kreuzzeichen auf die Stirn zu machen. Das ist was Daniel Kahneman assoziative Kohärenz nennen würde , das uns daran hindert, die Lüge oder Unwahrheit eines Arguments zu erkennen, weil es nicht zu unseren Bestrebungen oder Überzeugungen passt. Den Inka in Oberperu fiel es während der Kolonialzeit schwer zu akzeptieren, dass „ein Lamm Gottes die Sünden der Welt hinwegnehmen würde“ und dass die Anbetung der Sonne (Inti) oder des Mondes (Killa) zugleich ein Sakrileg war. Tausende von ihnen bezahlten ihre „Bekehrung“ und den Verzicht auf ihren Glauben mit ihrem Leben.
Die Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg Mitte des 15. Jahrhunderts war eine wahre technologische Revolution für die Menschheit. Die Annahme, zwischen der Erfindung des Buchdrucks und der Aufklärung bestehe eine direkte Verbindung, ist allerdings ein großer Irrtum. Bis zum Aufkommen von Leibniz und der Aufklärung herrschte mindestens 200 Jahre religiöser Obskurantismus, der durch die Veröffentlichung der Bibel und des Korans als Mittel zur Errichtung einer auf religiösem Fanatismus basierenden „Ordnung“ unbeabsichtigt gefördert wurde. Auch die rasche Verbreitung der berühmten Verleumdung „Der Hexenhammer“ war nur durch die Existenz der Druckerpresse möglich.
Die Hexenjagd ist ein Beispiel für die schrecklichen Auswirkungen, die all dies auf die Entwicklung der Menschheit hatte. Es genügte, dass eine kleine Gruppe bösartiger Subjekte den Mythos entwickelte, Hexen seien Teil einer globalen Verschwörung zur Vernichtung der Menschheit und begann mit der Jagd und Ermordung Hunderter unschuldiger, oft mit enormer Weisheit ausgestatteter Frauen. Es gab keine unabhängige Justiz über der Inquisition. Der Hexenhammer (Malleus Maleficarum) der österreichischen Mönche Heinrich Kramer und Jakob Sprenger hatte verheerende Auswirkungen auf die europäische Geschichte. Niemand machte sich die Mühe, die Studien von Kopernikus zu lesen, die gleichzeitig in Gutenbergs eigener Druckerei veröffentlicht wurden. Interessanter fanden die Leute Kramers makabre Geschichten, in denen es beispielsweise darum ging, wie Hexen Männern den Penis stahlen, um ihn in Bäumen zu verstecken. Aufgrund solcher erzählerischer Irrtümer wurden in Europa Zehntausende unschuldige Opfer von Intrigen hingerichtet.
Wen machen wir für solche Verbrechen verantwortlich? Gutenberg, den Erfinder des Buchdrucks? Die Druckerpresse selbst? Offensichtlich nicht. Hier entsteht Frage von Macht und Ordnung, ohne die solche Abweichungen unerklärlich sind. Die Institution, die die Druckerpresse nutzte, um mittels einer etablierten Ordnung, die auf narrativen Trugschlüssen basierte, Macht auszuüben, war damals die Kirche. Im oben genannten speziellen Fall die katholische Religion. Doch derartige Abweichungen waren nicht das Privileg der Religionen. In vielen Fällen waren diese nichts weiter als Mittel zur Ausübung von Macht. Hitler und der Nationalsozialismus in Deutschland, Stalin und der Kommunismus in Russland oder der Islamismus der Mullahs im Iran bestätigen ebenfalls, dass Informationsnetzwerke nur dann in die Macht gelangen können, wenn ihnen eine Ordnung aufgezwungen wird.
Was hat das alles mit Facebook, Elon Musk und Jeff Bezos zu tun? Eigentlich mehr, als wir uns vorstellen. Die Druckmaschine der Neuzeit sind digitale Plattformen. Und die neuen Schöpfer einer auf Fiktionen und Trugschlüssen basierenden Ordnung sind die Technomillionäre, die diese Netzwerke kontrollieren. Sie verfügen über die Macht, komplexe Algorithmen zu entwickeln, mit denen sie die primitivsten Emotionen des Menschen manipulieren können: Angst, Hass, Rache, Neid usw. Es sind diese Gefühle, die in den sogenannten „sozialen Medien“ oder Netzwerken für die meisten Klicks sorgen.
Im Zentrum dieser neuen Ära der Digitalisierung steht bekanntlich der Computer, also der Rechner. Um die gesamte Struktur zu verstehen, müssten wir uns die beiden Konzepte Algorithmus und KI genauer ansehen. Der Buchdruck war, ebenso wie die Dampfmaschine, eine entscheidende Erfindung für die Entwicklung der Menschheit und die Schaffung von Netzwerken. Doch der Buchdruck, die Dampfmaschine und die Atomenergie sind Instrumente, die nur durch Entscheidungen von Menschen funktionieren können, die außerhalb dieser Instrumente stehen. Ohne das Eingreifen des Menschen sind solche Erfindungen tote Materie. Computer bzw. ihre Algorithmen hingegen können selbstständig Entscheidungen treffen und werden so zu Agenten. In bestimmten Fällen – etwa bei Facebooks eigenen Algorithmen – können sie verheerende Auswirkungen haben, wie der durch den Facebook-Algorithmus geförderte Völkermord an den Rohingya in Myanmar zeigt. Heute sind Algorithmen in der Lage, selbstständig Fake News und Verschwörungsmythen zu generieren, ohne das direkte Eingreifen der Experten, die sie einst programmiert haben.
Was ist KI wirklich? Harari fragt sich das immer wieder. Hollywood-Filme waren die ersten, die darauf aufmerksam machten. Doch beide „Matrix" auch "Terminator" Viele andere taten dies, indem sie die falsche Seite des Problems betonten: Eine Armee von Robotern, die unabhängig handelt, um die Menschheit von außen zu beherrschen. Die wirkliche Bedrohung durch KI kommt laut Harari nicht „von außen“. Bei dieser Bedrohung handelt es sich um eine konzentrierte und kaum wahrnehmbare Aktion, die sich innerhalb von Prozessen entwickelt, die auf den ersten Blick trivial erscheinen. Es geht vielmehr darum, dass von der KI erstellte Algorithmen über entscheidende Aspekte menschlichen Handelns entscheiden könnten, etwa über die Tätigung einer finanziellen Investition oder die Auswahl einer Person für eine Rolle oder Stelle in einem Unternehmen.
Ein weiterer, vielleicht wichtigerer Aspekt betrifft die Notwendigkeit der Regulierung bzw. Kontrolle künstlicher Intelligenz angesichts eines Wettlaufs zwischen den Großmächten China und den USA. Geht es darum, langsamer zu werden? Um den Prozess der KI-Ausbreitung zu verlangsamen? Was würde nun passieren, wenn die Vereinigten Staaten beschließen würden, langsamer vorzugehen? Ja, Sie entscheiden sich beispielsweise, ChatGPT-4 ein Timeout zu gewähren. Konkurrenten wie China werden sich dazu entschließen, ihre KI-Prozesse weiter zu beschleunigen, um sich einen Vorteil zu verschaffen, und der Erfolg von DeepSeek ist nur eines von vielen Szenarien. Und umgekehrt. Das Endergebnis könnte sein, dass weder China noch die Vereinigten Staaten, sondern die KI selbst den ultimativen Vorteil gegenüber allen Menschen erlangt, ob Chinesen oder Amerikaner.
Nach Jahrhunderten der selbstgesteuerten Evolution sei der Mensch zum ersten Mal mit der Gefahr konfrontiert, von der KI gesteuert zu werden, einer seltsamen, anorganischen Kraft, sagt Harari. Derzeit kursiert in Deutschland eine Anzeige mit dem Angebot, mit geliebten Menschen auch nach ihrem Tod in Kontakt zu bleiben. Dabei handelt es sich nicht um eine esoterische Vision, sondern vielmehr um die Ansammlung einer großen Menge an Informationen über eine Person, und zwar in einer Weise, die es den Angehörigen ermöglicht, selbst nach dem Tod der Person verständliche Antworten von einem Chatbot zu erhalten. Es bedarf keiner großen Anstrengung, diese Situation zu extrapolieren und zu erkennen, dass die Grenzen, denen wir Menschen unterliegen, wie etwa der Tod, durch Maschinen überwunden werden können, da es sich bei ihnen nicht um organische Materie handelt.
Plattformen wie Facebook, Amazon oder „X“ verbreiten gezielt bestimmte Botschaften und beeinflussen die Meinung ihrer Kunden. Die Behauptung, sie würden lediglich „den Launen ihrer Klienten und staatlichen Vorschriften gehorchen“, ist übrigens wenn nicht falsch, so doch zumindest höchst fragwürdig. Damit schließt sich Harari den Stimmen an, die schon seit längerem fordern, dass diese Plattformen für die Auswirkungen ihrer Algorithmen auch die rechtliche Verantwortung übernehmen. Ebenso wie die Herausgeber von Zeitungen und anderen Publikationen verfügen die Eigentümer digitaler Plattformen über enorme Macht und Verantwortung. Es ist kein Zufall, dass große Technologieunternehmen im Jahr 2022 mehr als 70 Millionen US-Dollar für die Finanzierung von Lobbyarbeit bei der US-Regierung und weitere 113 Millionen US-Dollar bei EU-Regierungen ausgegeben haben, um eine strengere Regulierung ihrer Algorithmen zu verhindern.
In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu betonen, dass für Harari dieser weit verbreitete Glaube an einen „technologischen Determinismus“ in vielen Fällen gefährlich ist, da er die Menschen von ihrer Verantwortung befreit. Dies könnte in gewissem Widerspruch zu der These des spanischen Philosophen und Physikers stehen Adrián Almazán, für die die angebliche Neutralität der Technologie ein Trugschluss ist. In seinem faszinierenden Buch über den Mythos der Technologie greift Almazán auf Cornelius Castoriadis’ Konzept des „sozialen Imaginären“ zurück, um den von ihm so genannten „Techno-Optimismus“ zu rechtfertigen, der uns daran gehindert hat, eine Art Philosophie der Technik (und der Technologie) zu entwickeln. Dies ist jedoch nicht der Weg, den Harari in seinem Nexus verfolgt, und deshalb werden wir es als offenes Thema in diesem Blog belassen.
Ein Großteil von Hararis Argumentation konzentriert sich auf die deutlichen Unterschiede zwischen Demokratien und Diktaturen bzw. autokratischen Systemen hinsichtlich der Aktivierung von Instrumenten zur Kontrolle der Manipulation von Informationen auf der Grundlage fortschreitender technologischer Innovationen. Als Beispiel hierfür könnte die Gesichtskontrolle genannt werden, die in China mit einem Punktesystem verknüpft ist, um Personen zu bestrafen, die eine Übertretung begehen (sei es das Überfahren einer roten Ampel oder die Teilnahme an einer Demonstration).
Um als KI definiert zu werden, muss eine Maschine in der Lage sein, selbstständig zu lernen und sich zu verändern. Wenn die Maschine hierzu nicht in der Lage ist, kann sie nicht als KI definiert werden. Deshalb kann GPS allein nicht als KI betrachtet werden, es sei denn, es ist mit einem Algorithmus verknüpft, der beispielsweise die Integration zweier funktionaler Aspekte ermöglicht: Fahren und Straßenumgebung. Die Gefahr liegt darin, dass sich die KI von einem einfachen Werkzeug zu einem Agenten entwickelt hat und als solcher in der Lage ist, selbst Prozesse zu gestalten, die nicht immer vom Menschen kontrolliert werden können. Diese Akteure schaffen Prozesse in strategischen Bereichen des menschlichen Lebens, etwa in Finanzsystemen, Waffensystemen oder Gesundheitssystemen. Nachdem der anfängliche Optimismus verflogen ist, wachsen bei Politikern und Experten die Sorgen. Die Veränderungen vollziehen sich mit enormer Geschwindigkeit, ohne dass sich die Gesellschaften daran anpassen können. Angesichts der Tatsache, dass die KI mit enormen Datenmengen und hochdynamischen, mittlerweile extrem komplexen Algorithmen arbeitet, scheint die Fähigkeit, diese zu verwalten und zu kontrollieren, rapide abzunehmen.

Auf internationaler Ebene scheinen sich bereits eine Art Informationskolonialismus und digitale Imperien herausgebildet zu haben. Viele Nationen könnten zusammenbrechen, weil ihnen die Informationen oder der Zugang zur KI fehlen. Im sogenannten „Worst Case“: Die KI erobert den Planeten und beherrscht den Menschen als bewusstes Wesen (fähig zu lieben, zu leiden, zu genießen, zu helfen usw.). Wie wahrscheinlich ist ein solches Szenario? Dieses Szenario erscheint immer noch unwahrscheinlich.
„In der Steuerliteratur bezieht sich „Nexus“ auf die Verbindung einer Entität zu einer bestimmten Gerichtsbarkeit.“ Dies bedeutet, dass der „Steuernexus“ eines Unternehmens oder einer juristischen Person von seiner physischen Präsenz in einem bestimmten Land oder Gebiet abhängt. Wie allgemein bekannt ist, ist es äußerst schwierig, große digitale Plattformen mit nationalen Steuerbehörden zu verknüpfen, da sie über keine „physische Präsenz“ verfügen. Sie sind nicht analog, sondern digital, fast ätherisch. Ein Vorschlag zur Lösung der durch Computernetzwerke verursachten Steuerdilemmas besteht in der Neudefinition des Nexus. Harari beruft sich dabei auf den renommierten Ökonomen Marko Köthenbürger, der glaubt, dass „die auf einer physischen Präsenz basierende Definition von ‚Nexus‘ überarbeitet werden muss, um die Idee einer digitalen Präsenz in einem Land einzubeziehen.“
In einem seiner Abschnitte macht sich Harari Gedanken über die Auswirkungen, die die Dominanz und Machtanhäufung der von ihm so genannten „anorganischen Netzwerke“ auf menschliche Netzwerke haben wird. Die aktuelle Situation, in der extrem mächtige Algorithmen wie die von Facebook oder TikTok über enorme Manipulationsmacht verfügen, bedarf keiner detaillierten Analyse, und meiner Meinung nach greift Hararis Analyse zu kurz, wenn man berücksichtigt, dass er und Andere Autoren hatten die Macht von Amazon analysiert, einem weiteren Großen, wenn es um die Beherrschung menschlicher Netzwerke geht.

Für Harari ist es wichtig aufzuzeigen, wie es leistungsstarken Algorithmen und der künstlichen Intelligenz (KI) (verstanden als „die von bestimmten Algorithmen entwickelte Fähigkeit, selbstständig zu lernen und sich zu verändern“) bereits gelungen ist, wichtige Aspekte menschlicher Aktivität zu besetzen. Die Folgen einer solchen Machtkonzentration in solchen Netzwerken sind offensichtlich unkontrollierbar und die Eigentümer solcher Algorithmen entziehen sich jeglicher Verantwortung für etwaige negative Auswirkungen. Aus diesem Grund stehen „menschliche Netzwerke“ wie die Europäische Union oder bis vor kurzem auch die Vereinigten Staaten von Amerika vor der schwierigen Aufgabe, eine Rechtskonstruktion zu schaffen, die eine stärkere Kontrolle und Regulierung ermöglicht. Auf eine Antwort sind sich die Forscher einig: Der grundlegende Auslöser für die Aktivierung der autoritären Veranlagung ist die Wahrnehmung einer „Bedrohung“.
Das vielleicht symbolträchtigste Foto von Donald Trumps Amtseinführung ist das, in dem Zuckerberg (Facebook), Bezos (Amazon) und Musk („X“) auftreten. Was Harari in seinem Werk nicht darlegte, ist die Realität, die uns heute heimsucht: Die „Heilige Allianz“ zwischen einer technologischen Oligarchie und einer Regierung mit ultrarechten und rassistischen Tendenzen wie der von Donald Trump. Wie Katharina Pistor richtig bemerkt, ist allein der Anblick der Gründer und CEOs der großen Technologieunternehmen, die bei Donald Trumps Amtseinführung in der ersten Reihe vor seinem Kabinett sitzen, schon ein klares Statement: Wir sind Zeugen einer Machtübernahme durch die mächtigsten Privatkonzerne der Welt. Die Geschichte der Menschheit lehrt uns, dass dies letztlich für niemanden gut ausgeht. Werden wir gezwungen sein, jeglichen Anspruch auf mehr Bürgerdemokratie aufzugeben und stattdessen eine unabhängige Regierung anzustreben, die in der Lage ist, die großen Privatkonzerne zu regulieren und zu demokratisieren? Besteht zwischen diesem Dilemma und dem Dilemma, das Harari in seinem wertvollen Werk aufzeigt, ein Zusammenhang?
Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, in dieser kurzen Rezension auf Naim zurückzukommen, wenn er uns auffordert, eine Strategie aus fünf Schlachten zu entwickeln, um die Seele der Demokratie wiederzuerlangen: 1. Die Schlacht gegen die große Lüge. Wir brauchen digitale Hygiene, um informierte und reaktionsschnelle Bürger zu sein. 2. Der Kampf gegen Regierungen wurde kriminell. Wir müssen die falschen Wohltätigkeitsorganisationen dieser Autokraten aufdecken, beim Namen nennen und entlarven. 3. Der Kampf gegen Autokratien, die versuchen, Demokratien zu schwächen. 4. Der Kampf gegen politische Kartelle, die den Wettbewerb ersticken. 5. Der Kampf gegen illiberale Narrative. Wir müssen den Menschen immer wieder sagen, dass die Rhetorik des 3P-Autokraten oberflächlich und hohl ist.
Für Populisten ist Macht die einzige Realität und der Kampf um die Wahrheit wird dem Kampf um die Macht untergeordnet. Die Entstehung einer neuen Oligarchie rund um die populistische Regierung von Donald Trump könnte diesen neuen Mix aus Macht und künstlicher Intelligenz verkörpern. Meiner Meinung nach könnte uns die Philosophie hier einige wichtige Hinweise geben. Als Wissenschaft definiert als „Liebe zur Wahrheit“ erinnert uns die Philosophie lediglich daran, dass die Liebe des Menschen zur Wahrheit in der Vergangenheit gegen die dunklen Instinkte der Macht gesiegt hat. Die Überwindung dieses großen Dilemmas hängt nicht von der Erfindung einer weiteren Wundertechnologie ab. „Um klügere Netzwerke zu schaffen, müssen wir vielmehr sowohl die naive als auch populistische Vorstellung von Information aufgeben, unsere Unfehlbarkeitsfantasien beiseite legen und uns der harten und eher prosaischen Arbeit widmen, Institutionen mit robusten Selbstkorrekturmechanismen aufzubauen. „Dies ist vielleicht die wichtigste Lektion, die dieses Buch bieten kann.“ Meiner Meinung nach ist der Epilog dieses großartigen Werks Pflichtlektüre.
Almazán, Adrián (2021). Técnica y tecnología: Cómo conversar con un tecnolófilo (Spanish Edition) Taugenit Editorial. Kindle-Version
Harari, Yuval Noah (2024). Nexus: Una breve historia de las redes de información desde la Edad de Piedra hasta la IA (Spanish Edition). DEBATE. Kindle-Version.
Naím, Moisés (2022). La revancha de los poderosos: Cómo los autócratas están reinventando la política en el siglo XXI (Spanish Edition). DEBATE. Kindle-Version.